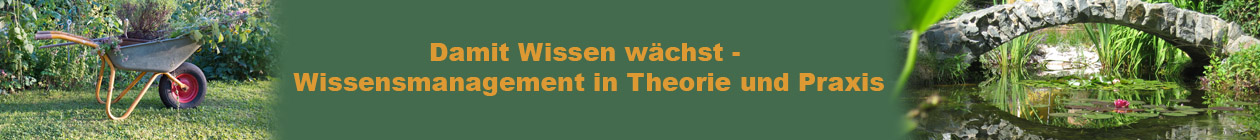heute geht es los, wie immer zum Tag der Deutschen Einheit, am 3. Oktober.
Nun schon seit 2016 findet jährlich diese offene und professionelle Online Aus- und Weiterbildung (MOOC) zum Wissensmanagement (intelligenter Umgang mit Wissen) statt.
Wissen und „intelligenter Umgang mit Wissen“ ist sowohl die Basis fachlichen als auch gesellschaftlichen Fortschritts. Deshalb freuen wir uns besonders, diese Weiterbildungsmöglichkeit kostenfrei für Alle anbieten zu können. Wir, das sind Gabriele Vollmar und Dirk Liesch und natürlich unsere „Mitmacher„. Wie Ihr selbst mitmachen und unterstützen könnt, findet Ihr unter „Mitmachen 2021„. Auch wenn wir seit 2016 dieses Angebot fast ausschließlich ehrenamtlich als „Überzeugungstäter:in“ anbieten, freuen wir uns natürlich über Unterstützerinnen und Sponsoren.
Vier Monate, mit jeweils drei Wochen/Monat dauert diese Online Aus- und Weiterbildung, die sich am „Kompetenzkatalog-Wissensmanagement“ orientiert, welcher durch eine Arbeitsgruppe der Gesellschaft für Wissensmanagement (GfWM e.V. ) erarbeitet wurde. Dabei wird das theoretische Wissen zur Rolle „Wissensmanagerin / Wissensmanager“ vermittelt. Aber auch wenn Du Dich nur für einen Teilbereich, z.B. die „Wissensweitergabe“ oder „persönliches Wissensmanagement“ interessierst, bist Du hier richtig. Der komplette Kurs ist mit einem zeitlichen Aufwand von ca. 3h/Kurswoche geplant. Wer möchte, kann danach auch eine Prüfung ablegen.
Unsere „Live Sessions“, oft mit GURUs des jeweiligen Themenbereichs, sind der Grund, warum uns viele Teilnehmerinnen schon seit einigen Jahren kontinuierlich begleiten.
Unsere Auftaktveranstaltung (erste Live Session) in diesem Jahr findet am Mittwoch, den 6. Oktober um 14 Uhr : „Einführung in den WMOOC“ (Ablauf, Organisatorisches usw.) mit Gabriele & Dirk
Die Einwahldaten zur Live-Session und die gesamte Beschreibung der Inhalte für die kommende Woche findest du (nach Anmeldung) direkt auf der oncampus-Plattform: https://mooin.oncampus.de/course/view.php?id=57&chapter=1&selected_week=4
Während der WMOOC-Zeit senden wir jede Woche eine „Wochen-Mail“ mit den Inhalten und Themen der kommenden Woche, inklusive Thema, Referent:in, Termin und Einwahldaten der nächsten Live-Session. Um diese zu erhalten, musst Du Dich für unseren Newsletter anmelden. (Wir versprechen: kein Spam und Abmeldung mit zwei Klicks möglich, auch direkt aus jeder Mail).
Wenn Du noch Freunde, Kolleginnen oder Bekannte hast, für die unser Wissensmanagement MOOC (WMOOC) eine Bereicherung sein könnte, informiert sie. Denn je mehr wir sind, die aktiv dabei sind, desto vielfältiger wird auch der interaktive Austausch.
Außerdem wäre es toll, wenn wir deses Jahr über 2.000 eingeschriebene Teilnehmer:innen erreichen. Derzeit sind es über 1.900 aus 34 Ländern (obwohl der Kurs nur in „Deutsch“ stattfindet).
Dann auf einen spannenden und anregenden gemeinsamen MOOC zum Thema Wissensmanagement 2021!
Gabriele & Dirk