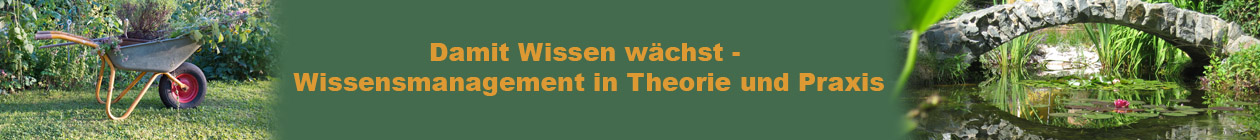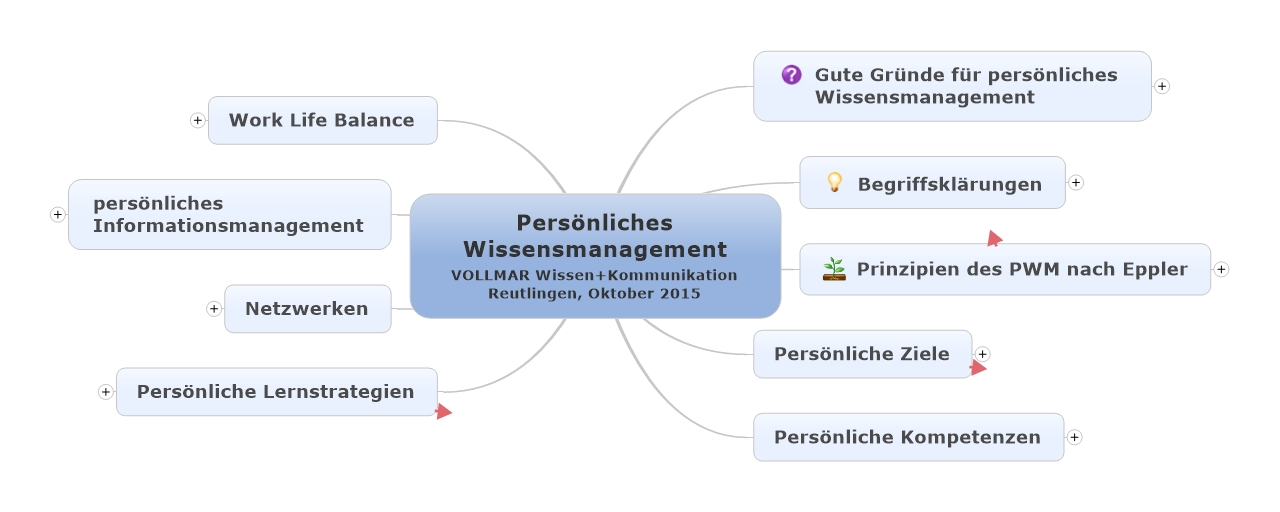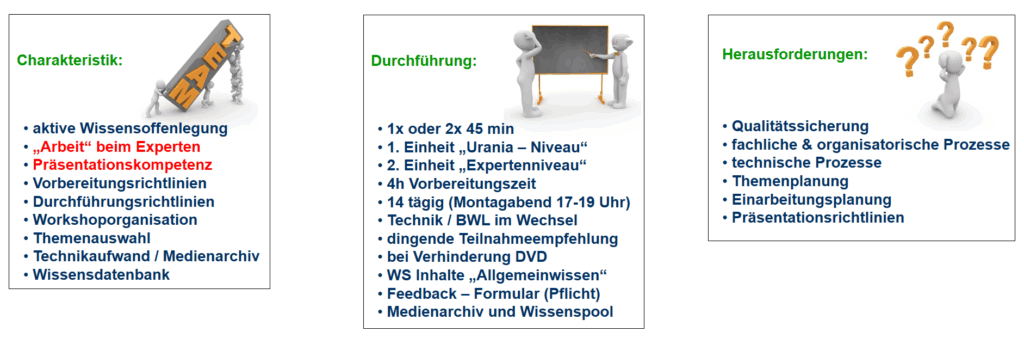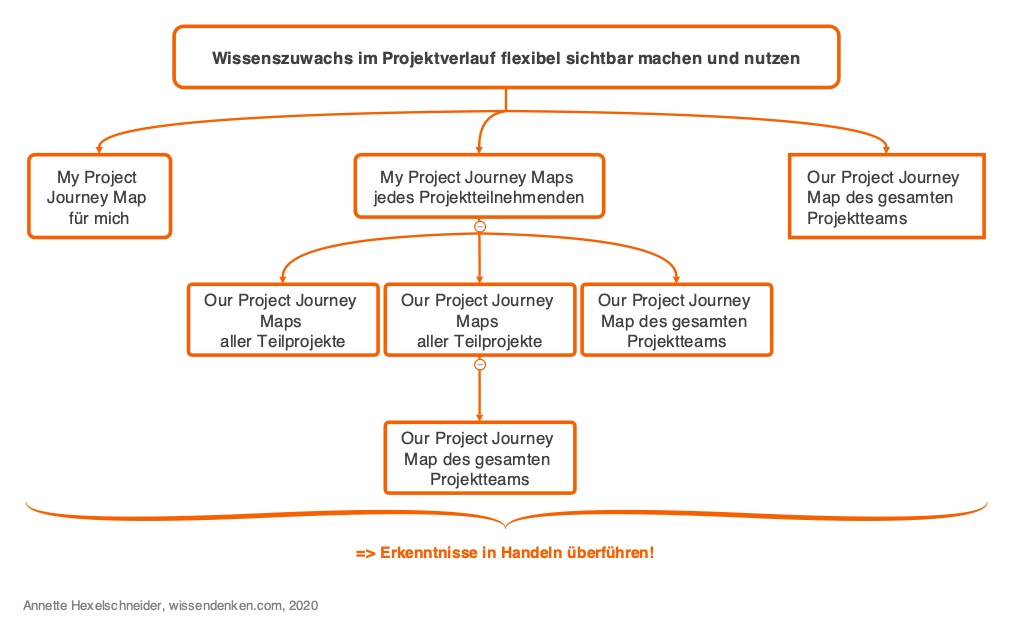Vor allem die generative künstliche Intelligenz kann im persönlichen Wissensmanagement die Rolle einer fleißigen und engagierten Assistenz übernehmen und uns Wissensarbeitende in einigen Bereichen gut entlasten – damit mehr Zeit für die wirklich kniffligen Fragen und kreativen Aufgabenstellungen bleibt.
Hinweis: Da sich die KI-Tools sehr dynamisch entwickeln und wir mit dem freien Kursbuch neutral bleiben wollen, nennen wir keine Tool-Beispiele. Aber sicher kennst du bereits zahlreiche KI-Anwendungen.
Die Live-Session „Wissensmanagement x KI – Macht generative KI das persönliche Wissensmanagement 50% produktiver?“ aus dem WMOOC 2025 gibt einen sehr guten Einblick in die aktuellen unterstützdenden Möglichkeiten von KI (Dauer: 1h 19min):
Informationsrecherche und -filterung
KI kann über eine Intelligente Suchfunktionen, die kontextbezogen arbeitet, dabei helfen, relevante Informationen aus großen Datenmengen schnell zu finden. Sie kann lange Inhalte zusammenfassen und/oder strukturieren und/oder vergleichen. Und sie kann Vorschläge für weiterführende Quellen oder verwandte Themen machen.
Wissensorganisation
KI-gestützte Tools können auf Basis einer semantischen Inhaltsanalyse Inhalte kategorisieren, verschlagworten (automatisches Tagging) und ggf. in Wissensdatenbanken einpflegen.
Content-Erstellung und -Transformation
Generative KI kann dabei helfen, Inhalte zu erstellen oder zu überarbeiten, z. B. Textentwürfe für Präsentationen, Berichte oder Blogposts, Visualisierungen, Videos, Podcasts, Mindmaps oder Übersetzungen und Lektorate zur sprachlichen Optimierung der eigenen Texte. KI kann außerdem Informationsformate umwandeln (z. B. Text in Podcast) oder Audio transkribieren.
Sparringspartnerin
Eine KI kann bei der Reflexion und Entscheidungsfindung unterstützen. Z.B. indem man ihr die eigenen Überlegungen schildert und um ein Feedback bittet oder nach Alternativen fragt. Oder indem man die KI eine Pro-und-Kontra-Liste erstellen lässt. Zur Vorbereitung auf eine Diskussion oder Präsentation, eine Prüfung oder eine Verhandlung kann man die KI bitten die eigenen Argumente und Thesen zu hinterfragen und Gegenargumente zu liefern. Ebenso kann sie dabei helfen neue Ideen zu entwickeln.
(Lern)Coach
KI kann als persönlicher Lerncoach agieren, z. B. persönliche Lern- oder Trainingspläne basierend auf dem jeweiligen Wissens- oder Leistungsstand erstellen, Wiederholungsmechanismen etablieren (z. B. Spaced Repetition) oder Quiz- und Übungsfragen zur Selbstüberprüfung erzeugen.
Gedächtnisstütze und Erinnerungen
KI kann dich an wichtige Inhalte oder Aufgaben erinnern:
– Automatisierte To-do-Listen mit Kontextbezug
– Verknüpfung von Informationen mit Kalenderereignissen
– Vorschläge für Wiederholung oder Vertiefung
Wie immer gilt auch hier: Vorsicht und Kontrolle:
- Datenschutz: Achte darauf, welche persönlichen Daten du mit KI-Tools teilst.
- Qualitätssicherung: KI kann Fehler machen – prüfe wichtige Inhalte kritisch.
- Kontrolle: Behalte die Kontrolle über deine Inhalte.
Weiterführende Informationen:
Im WMOOC 2023 gab es eine tolle Live Session mit Barbara Geyer von der Hochschule Burgenland zu Erfahrungen mit KI im persönlichen Wissensmanagement:
Künstliche Intelligenz für die persönliche Wissensarbeit (Live Session)
Kommentare/Hinweise:
Wir freuen uns über Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge. Gerne per eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).