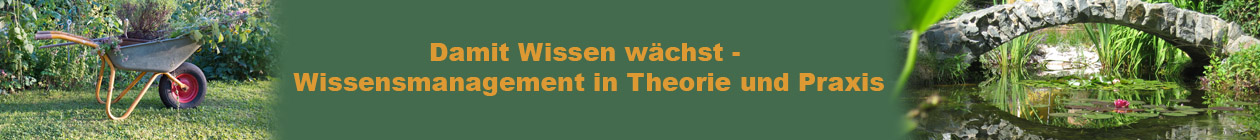Wenn die Vernetzung von Experten in der eigenen Organisation und die Nutzung deren Kompetenz auch übergreifend, evtl. auch international, ein Thema ist, ist dies eine interessante Beispiellösung für größere Organisationen.
Dieses Video zur Bosch Expert Organization (BEO) entstand mit Jürgen Ebmeyer und Lothar Maier (zwei BEO-Machern von Bosch) als Praxisbeispiel im Rahmen des Wissensmanagement-MOOC 2017 gemeinsam mit der GfWM Regionalgruppe Stuttgart. An die ca. 36 min Vortrag und Vorstellung von BEO schließen sich weitere ca. 36 min Fragen und Antrworten an (gesamt: 1h 12 min):
Inhalts-Index zum Video:
- 00:00 min: Vorstellung
- 00:40 min: Bosch und Abteilung
- 04:06 min: BEO Bosch Experts Organization – Einleitung
- 05:12 min: Motivation zur Wissensteilung
- 09:05 min: Geschichte von BEO
- 10:36 min: 3 Elemente von BEO heute
- 13:21 min: Wie wird man BEO-Experte?
- 16:36 min: die Rolle BEO Experte (Erwartungen, Aufgaben)
- 18:27 min: Suche nach einem Experten oder einer Community
- 20:41 min: Bosch Topic Areas (Taxonomie)
- 21:44 min: Bosch als agile Organisation + Topic Areas
- 26:23 min: Agile Zusammenarbeit und Ideen-Verwirklichung
- 29:18 min: Wichtige Etappen in der Entwicklung von BEO und vom knowledge management zu competences
- 34:08 min: Facts and Figures zu BEO
- 36:57 min: Ende des Vortrages, Beginn der Fragerunde (nur noch Audio)
- 37:26 min: Was waren wichtige Gründe für die Entwicklungsschritte seit 1996?
- 40:55 min: Was wird als Enterprise Search verwendet?
- 41:06 min: Hängt BEO auch mit der Bosch Fachkarriere zusammen?
- 41:48 min: Gibt es noch allgemeinere WM-Bereiche?
- 43:44 min: Wo mussten Sie welche Erfahrungen sammeln, die zum jetzigen BEO Ergebnis geführt haben?
- 45:00 min: Messen Sie den Erfolg von BEO?
- 46:26 min: Gibt es Anreizsysteme für die Expertenrolle?
- 47:27 min: Wie steht Betriebsrat zu Themen der „Experten-Findung?
- 48:21 min: Wie erfährt ein neuer Mitarbeiter, dass es BEO gibt?
- 49:06 min: Spüren die Kunden schon etwas von der Agilität?
- 50:24 min: Was passiert, wenn ein Experte vorgeschlagen wurde und nicht möchte?
- 51:02 min: Was ist, wenn sich ein Experte im Nachhinein nicht als Experte herausstellt?
- 51:51 min: Missbrauch (Headhunter Thema) – ist das ein Problem, wie ist Umgang damit?
- 54:18 min: Welche Entwicklungen gibt es hinsichtlich der Expertenzahl und aufs Vorschlagswesen?
- 56:12 min: Wie sind die Vorgehensweisen hinsichtlich Sprachen und Übersetzungen?
- 58:21 min: Zeigen Sie auch Kompetenzen an, die nicht direkt mit dem Job zusammenhängen?
- 59:20 min: Welche Länder sind besonders aktiv?
- 60:00 min: Gibt es online Workshops oder Qualitätszirkel?
- 61:44 min: Wie ist der Austausch der Experten untereinander?
- 62:10 min: Präsentieren die Experten ihre Ergebnisse auch?
- 62:47 min: Wieviele Menschen/Admins betreuen BEO?
- 64:30 min: Was waren die größten Herausforderungen und Konfliktpotentiale bei der Einführung von BEO?
- 71:37 min: Kann auch das Management an BEO teilnehmen?
Kommentare/Hinweise:
Wir freuen uns über Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge. Gerne per eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).