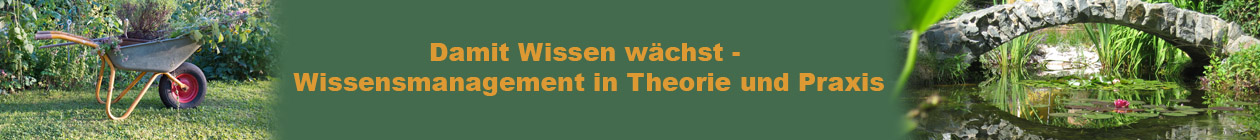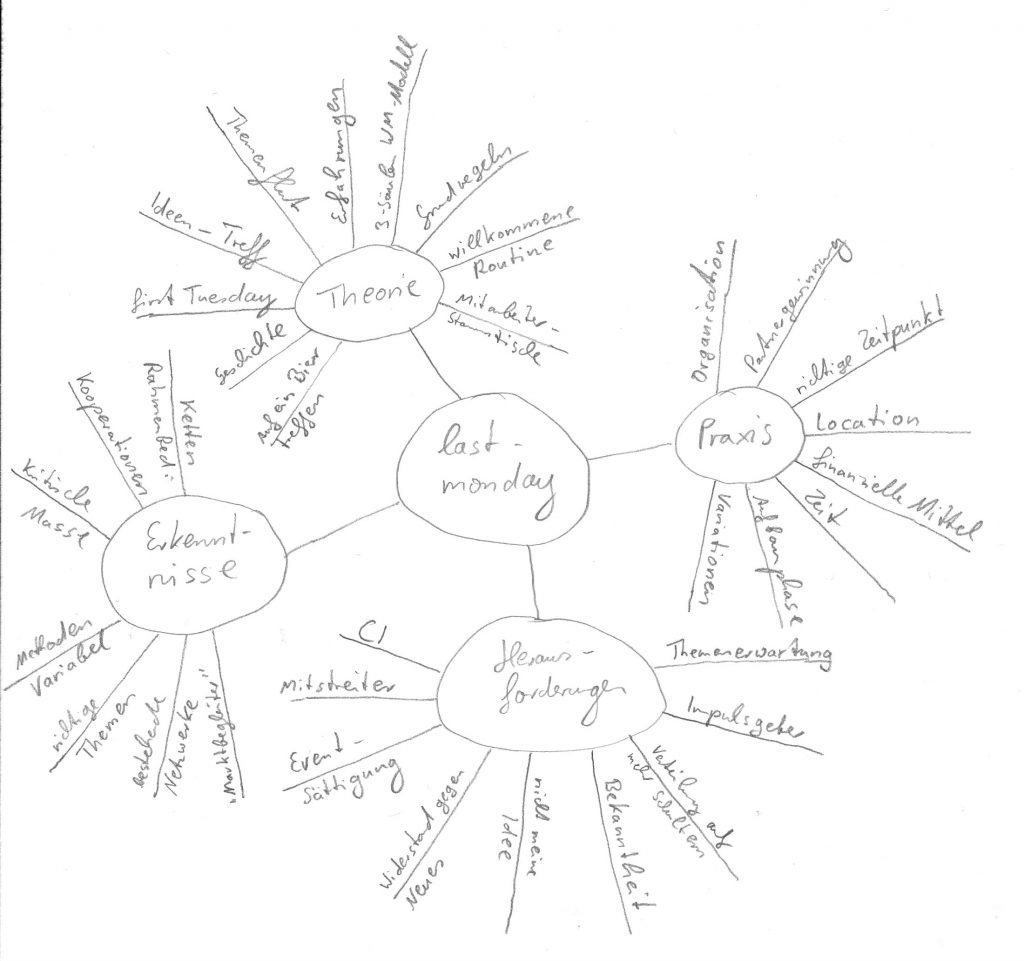Brainstorming Methoden sind sehr gut geeignet, um neue Ideen und neues Wissen zu generieren, bzw. neue Lösungen für aktuelle Probleme / Herausforderungen zu finden. Es gibt sehr viele Brainstorming Methoden, im Folgenden sind die drei wichtigsten Vorgehensweisen aufgeführt.
635 Methode
Die 635 Methode ist eine Kreativitätstechnik und eine besondere Form von Brainwriting.
Das Ziel ist es in einer Gruppe – wie beim Brainstorming auch – möglichst viele Ideen zu einem bestimmten Problem zu generieren und so dieses Problem zu lösen.
Vorgehen:
Klassisch wird die 635 Methode in einer Gruppe von 6 Personen angewandt. Alle Teilnehmer erhalten ein zuerst leeres Blatt Papier. In der ersten Runde werden alle Teilnehmer aufgefordert, in 5 Minuten drei Ideen zur Problemlösung aufzuschreiben. Nach Ablauf der Zeit tauschen die Teilnehmer im Uhrzeigersinn die Blätter durch. In der nächsten Runde generieren die Teilnehmer wieder drei Ideen, bauen dabei jedoch auf den Ideen des Vorgängers auf und entwickeln diese Ideen weiter. Die Blätter werden so lange durchgetauscht bis jeder das Blatt von jedem Teilnehmer ergänzt hat.
Mit dieser Methode entstehen innerhalb von 30 Minuten maximal 108 Ideen: 6 Teilnehmer × 3 Ideen × 6 Zeilen.
Diese Methode wird auch in folgemdem englischen Erklärvideo: „Method 6-3-5 (BrainWriting)“ (4:50 min, linkmv97) erläutert:
Die entsprechende Wikipedia – Erläuterung zur 635 Methode ist relativ kurz und als prägnante Übersicht geeignet. Oft wird die 635 Methode auch direkt mit dem „Brainwriting“ gleichgesetzt.
Brainwriting
Brainwriting wird vor allem in Gruppen angewandt und ist sehr gut zur Ideengenerierung geeignet. Im Unterschied zum Brainstorming kann jeder Teilnehmer in Ruhe Ideen sammeln und diese aufschreiben. (ausführliche Wikipedia Beschreibung zum Brainwriting)
Brainstorming
Brainstorming ist eine Methode zum Finden von neuen Ideen und zur Problemlösung. Die Methode fördert das Erzeugen neuer auch ungewöhnlicher Ideen in einer Gruppe.
Es gibt sowohl moderiertes als auch nicht moderiertes Brainstorming. Ex gelten die folgenden Regeln: es sollen in kürzester Zeit möglichst viele Ideen generiert werden, Kritik und Korrekturen bei eingebrachten Ideen ist verboten, es können Ideen kombiniert werden, freies Assoziieren ist erwünscht.
Brainstorming findet in zwei Phasen statt:
Phase Eins: Ideen finden
Hier sammeln die Teilnehmer durch freies Assoziieren Ideen. Sie nennen spontan Ideen zur Lösungsfindung, wobei sie sich gegenseitig inspirieren und so neue Aspekte zur Problemlösung finden.
Phase Zwei: Ergebnisse sortieren und bewerten
Hier werden alle Ideen thematisch sortiert, problemferne Ideen aussortiert und Ideen auf Umsetzung hin bewertet.
Sehr kurz und prägnant wird die Methode in folgendem Video dargestellt: „Brainstorming – Wie man Ideen findet“ (1:48 min , phoenix):
Weiterführende Informationen:
Einige alternative Brainstorming-Ansätze sind im folgenden englischen Video „Six Creative Ways To Brainstorm Ideas“ (3:35 min, VM Measures) enthalten:
Was sind die „do’s“ und „dont’s“ beim Brainstorming. Das ist gut und kompakt in folgenden englischen Video erläutert: „Brainstorming Done Right!“ (3:41 min, Ed Muzio)
Was mit diesen Methoden erreicht werden soll, sind kreative Lösungen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass sich Kreativität nicht anordnen lässt und das harmonische Systeme dumme Systeme sind. Ebenso wichtig wie die Methode ist das Vorahndensein von „Störungen im System“. Was damit gemeint ist, erläutert das folgende Video genauer uns ausführlicher: „“Prof. Peter Kruse über Kreativität“ (7:34 min, Lutz Berger, lutzland)
Dieser Beitrag zu „Brainstormin Methoden“ ist auf Basis der Texte von Nadine Soyez entstanden.
Kommentare/Hinweise:
Wir freuen uns über Ergänzungs- oder Änderungsvorschläge. Gerne per eMail (unbedingt mit dieser URL) an uns Autoren (Gabriele Vollmar und/oder Dirk Liesch).